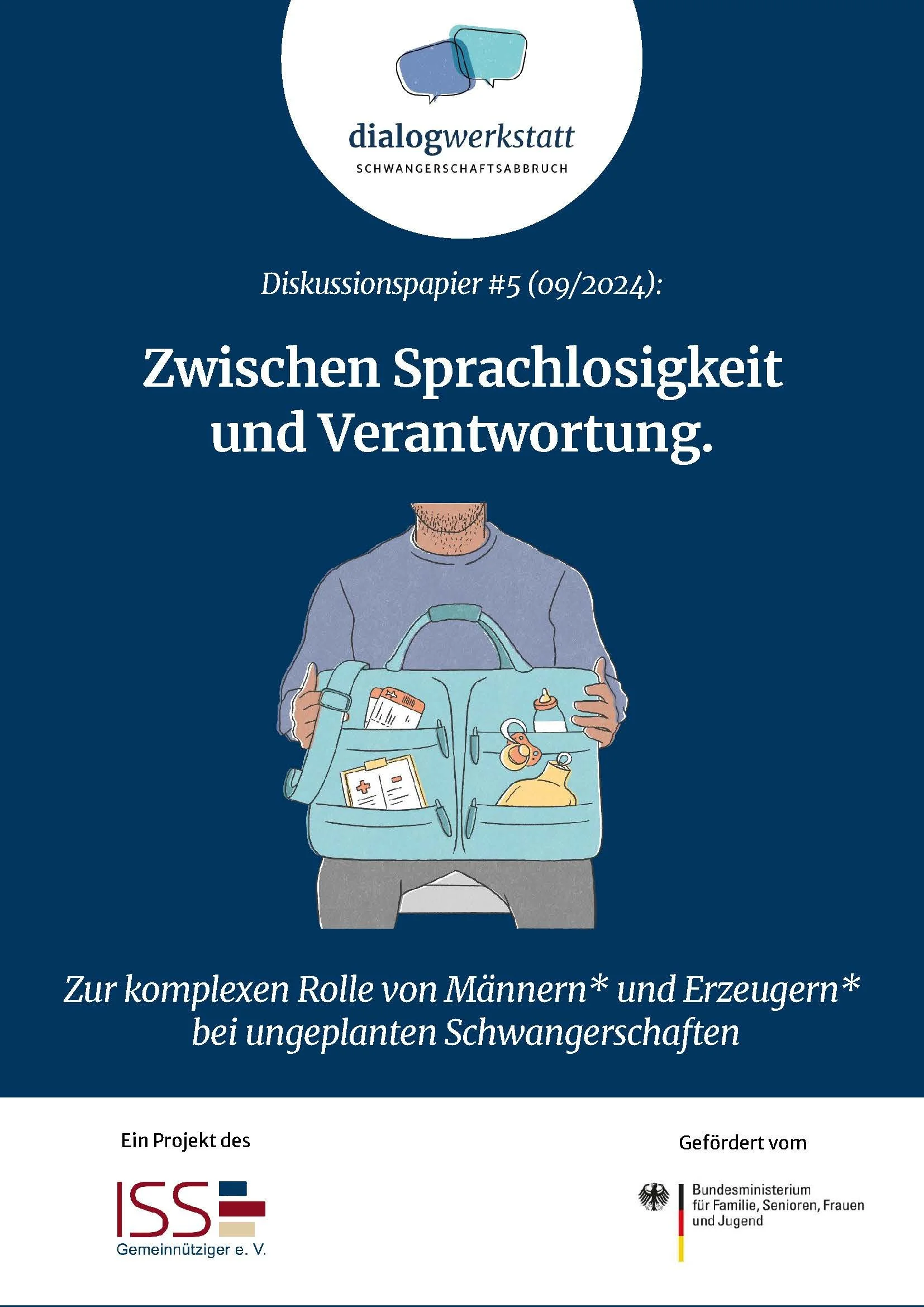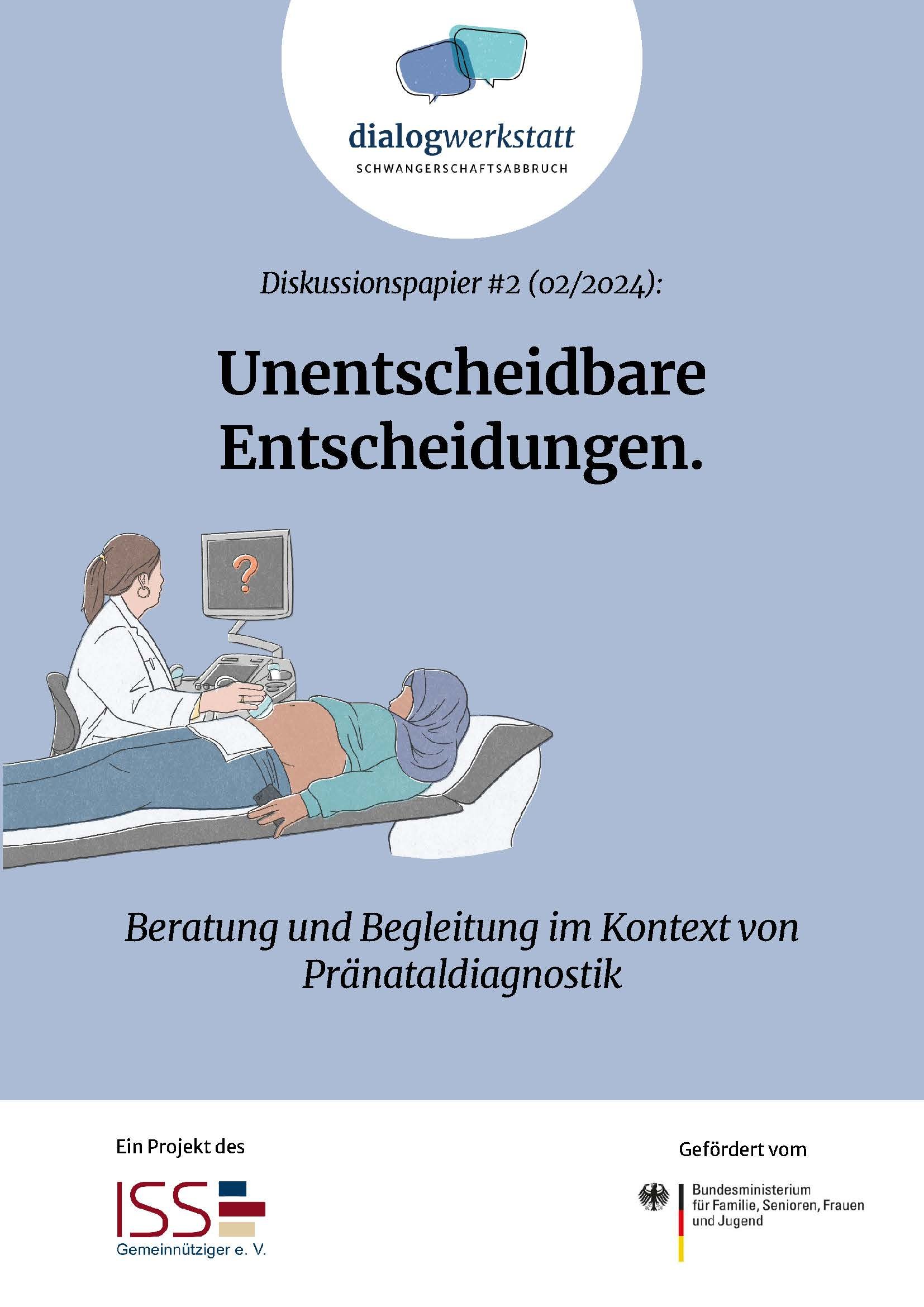Diskussionspapiere.
Die Teilnehmenden der Werkstatt widmen sich pro Treffen mindestens einer zentralen Fragestellung rund um Schwangerschaftsabbrüche.
Was ist der aktuelle Stand der Dinge, wo lassen sich Hindernisse und Bedarfe ausmachen? Und: Was ist die jeweilige Position der Mitwirkenden, wie unterscheiden sich einzelne Stimmen voneinander und wo können sie Gemeinsamkeiten finden?
Dieser Gesprächsprozess wird in einem Diskussionspapier pro Sitzung wiedergegeben. Das Papier ist explizit nicht als gemeinsames Sprachrohr der Teilnehmenden gedacht und wird von dem Projektteam des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik verfasst.
Expertisen.
Auf Basis wissenschaftlicher Fakten diskutieren – das funktioniert in der Dialogwerkstatt über sogenannte Expertisen. Gemeint ist damit eine Aufbereitung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die durch eine*n externe*n Wissenschaftler*in im Auftrag der Werkstatt verfasst wird.
Als Vorbereitung für jede Sitzung erhalten die Teilnehmenden ein Faktenblatt, dessen Thema sie zuvor gemeinsam festlegen. Die Faktenblätter dienen als Gesprächsgrundlage und können gleichzeitig Anstoß für das Aufgreifen anknüpfender Themen bieten.
Diskussionspapier #6 (Dezember 2024)
Judith Dubiski, Alina Jung, Theresa Köchl, Dr. Alexa Nossek, Wolfgang Kleemann
Keine Demokratie ohne Dialog.
Die 5 wichtigsten Erkenntnisse
-
Räume, in denen Menschen sich begegnen und kennenlernen, eröffnen Möglichkeiten des Dialogs - auch zu konflikthaften Themen. Dabei muss es nicht das Ziel sein, zu einer gemeinsamen Haltung zu finden: denn andere Perspektiven kennenzulernen und zu akzeptieren ist in sich selbst schon ein wichtiger demokratischer Prozess.
-
Um Dialog auch zu schwierigen Themen führen zu können, muss er sorgsam vorbereitet werden. Dazu gehört auch, solche Perspektiven, die im gesellschaftlichen Diskurs um das Thema unterrepräsentiert sind, von Anfang an mit einzubeziehen und sichtbar zu machen.
-
Ein Dialogprozess kann nur mit guten Rahmenbedingungen gelingen. Das braucht:
- ausreichend Zeit (genügend Treffen über einen entsprechend langen Zeitraum)
- Aufwandsentschädigungen als Zeichen der Anerkennung für den Aufwand, der den Teilnehmenden entsteht -Mittel für Assistenz und Sprachmittlung, um auch Perspektiven miteinzubeziehen, die sonst zu kurz kommen
- Eine gemeinsame Wissensbasis, bspw. durch Expertisen, als ein wichtiges Hilfsmittel für den Dialog. -
In Online-Diskussionen zu Schwangerschaftsabbrüchen ist damit zu rechnen, dass sich zwei Gruppen verstärkt äußern: Betroffene, die eigene Erfahrungen teilen und Menschen, deren Meinung in der öffentlichen Debatte vermeintlich weniger gehört wird (z.B. Pro-Life-Vertreter*innen).
-
Das Thema „Schwangerschaftsabbruch“ online zu diskutieren, ist nicht automatisch ein „Shitstorm-Generator“: Viel mehr kann größtenteils respektvoller und konstruktiver Dialog geschaffen werden, indem User*innen zugehört wird, ihnen eigene Wortbeiträge gespiegelt und vertrauenswürdige Dritte (z.B. Content-Creator*innen) in den Dialog geholt werden. Eine Polarisierung im Sinne einer „Spaltung der Gesellschaft“ ließ sich online nicht durchgängig erkennen.
Diskussionspapier #5 (September 2024)
Judith Dubiski, Alina Jung, Theresa Köchl, Dr. Alexa Nossek
Zwischen Sprachlosigkeit und Verantwortung.
Die 3 wichtigsten Erkenntnisse
-
Die Verantwortungsübernahme von nicht-schwangeren Elternteilen wird nicht erst mit der Geburt eines Kindes relevant, sondern beginnt mit der Begleitung und Unterstützung der (ggf. ungewollt) schwangeren Person.
-
Sofern eine Schwangerschaft aus einer bestehenden Beziehung resultiert, müssen die Beziehung und mögliche Beziehungskonflikte in der Schwangerschafts(konflikt)beratung thematisiert werden. Dabei ist große Sensibilität und Aufmerksamkeit für mögliche Gewaltverhältnisse in der Beziehung notwendig.
-
Wir leben in einer Gesellschaft, die immer noch durch die Dominanz von Männern* geprägt ist. Wer also über Rollen und Bedürfnisse von Männern*/Partnern*/Erzeugern* bei einer ungeplanten Schwangerschaft spricht, sollte berücksichtigen: Zwischen der schwangeren Person und dem Erzeuger* kann ein Machtgefälle bestehen.
Expertise #5 (September 2024)
Dr. Anika Steger
Zwischen Betroffenheit und Pflichtgefühl. Schwangerschaftskonflikte der Nicht-Schwangeren. Eine Expertise zu Erfahrungen von Männern mit Schwangerschaftsabbrüchen.
-
Eine Schwangerschaft entsteht durch zwei Menschen - aber wieso sprechen wir in der öffentlichen Debatte eigentlich so wenig über den Erzeuger*? Wie erlebt und verarbeitet dieser einen Schwangerschaftsabbruch? Und welchen Einfluss haben dabei traditionelle Geschlechterbilder?
-
Dr. Anika Steger arbeitet als Referentin im öffentlichen Dienst. Im Rahmen ihrer Dissertation forschte sie zu Erfahrungen von Männern nach einem beunruhigenden pränatalen Befund in der Schwangerschaft der Partnerin. Danach widmete sie sich innerhalb weiterer qualitativer Forschungsprojekte unter anderem der biographischen Bedeutung von potentiell traumatisierenden Lebensereignissen und posttraumatischem Wachstum.
Mit ihrer wissenschaftlichen Verortung innerhalb der Rehabilitationswissenschaften steht die Gleichstellung von Menschen, die in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe gefährdet sind, im Fokus von Forschungsfragen und beruflichen Aktivitäten.
-
Hier geht’s zum vierten Diskussionspapier.
Diskussionspapier #4 (Juni 2024)
Judith Dubiski, Alina Jung, Theresa Köchl, Dr. Alexa Nossek
Gemeinsam Hürden nehmen.
Die 3 wichtigsten Erkenntnisse
-
Wo kein Wissen, da kein Rat: Lösungen zum konstruktiven Umgang mit rassistischer Diskriminierung im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen bedürfen konkreter Zahlen – die bestehende Forschungslücke in dem Themenfeld muss also unbedingt geschlossen werden. Wir verstehen dies auch als Appell an Forschende und insbesondere an Zuwendungsgeber*innen, die Forschung finanzieren bzw. beauftragen.
-
Menschen, die rassistisch diskriminiert werden, sind rund um den Abbruch mit einer Vielzahl an Hürden konfrontiert: fehlende Sprachmittlung, unsichere Strukturen für die Finanzierung (z.B. bei illegalisierten Menschen), Stigmatisierung durch medizinisches Personal und fehlende Sensibilität für kulturelle Bedürfnisse (z.B. für muslimische Communities). Damit Schwangerschaftskonflikt-beratung passgenau durchgeführt werden kann und das Gesundheitssystem für alle Betroffenen zugänglich ist, müssen sich Strukturen grundlegend verändern – und nicht die Betroffenen sich an die Umstände anpassen.
-
Auch, wenn die Schwangerschaftskonfliktberatung per Gesetz zugänglich für verschiedene weltanschauliche Positionen sein sollte, ist sie dies aktuell nicht. Für muslimische Communities z.B. gibt es keine offiziell anerkannten Beratungsstellen – obwohl sich diese bereits darum bemühen. Hier braucht es eine geregelte Finanzierung für vielfältiger aufgestellte Beratungsstrukturen.
Expertise #4 (Juni 2024)
Anthea Kyere
Rassismus im Gesundheitswesen. Eine Expertise zur Auseinandersetzung mit Rassismus im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen.
-
Haben tatsächlich alle ungewollt Schwangeren den gleichen Zugang zu gynäkologischen Voruntersuchungen oder der Schwangerschaftskonfliktberatung? Auf welche Zugangsbarrieren stoßen rassistisch diskriminierte Personen im Kontext eines Abbruchs - und inwiefern sind diese Barrieren schon fester Bestandteil unseres Gesundheitssystems?
-
Anthea Kyere ist Sozialwissenschaftlerin und Antidiskriminierungsberaterin in Berlin. Sie ist in verschiedenen politischen Kontexten aktiv und Mitglied im Netzwerk Reproduktive Gerechtigkeit. In dem 2021 erschienenem Sammelband „Mehr als Selbstbestimmung! Kämpfe für reproduktive Gerechtigkeit“ schrieb sie über die Bedeutung von Reproduktiver Gerechtigkeit in Deutschland aus der Perspektive Schwarzer Frauen.
-
Hier geht’s zum vierten Diskussionspapier.
Diskussionspapier #3 (April 2024)
Judith Dubiski, Alina Jung, Theresa Köchl, Dr. Alexa Nossek
Gut beraten?
Die 3 wichtigsten Erkenntnisse
-
Nach der derzeitigen gesetzlichen Regelung müssen schwangere Personen sich vor einem Abbruch beraten lassen, auch wenn sie ihre Entscheidung bereits getroffen haben. Gleichzeitig gibt es Menschen, die Beratung und breitgefächerte Infos im Fall einer (un)gewollten Schwangerschaft oder eines Schwangerschafts-konflikts benötigen – diese aber nicht oder nur unzureichend erhalten. Hier geht es z.B. um Infos zu finanziellen Unterstützungsangeboten oder zum Ablauf und zur Nachsorge eines Abbruchs.
-
Gute Beratung muss individuell auf die zu beratende Person eingehen – dafür müssen Beratungsstellen kultursensibel, inklusiv, rassismus- und ableismuskritisch sein. Zusätzlich müssen die Berater*innen Rücksicht darauf nehmen, dass auch Menschen zu ihnen kommen, die bereits Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und sich daher möglicherweise verschlossener zeigen.
-
Derzeit erfüllt die Schwangerschaftskonfliktberatung eine Vielzahl von Funktionen – auch solche, die eigentlich nichts mit psychosozialer Beratung zu tun haben. So erhalten z.B. viele schwangere Personen erst in der Beratungsstelle wichtige Informationen wie Namen und Praxisadressen von Ärzt*innen in ihrer Region, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen.
Expertise #3 (April 2024)
Dr.in Christiane Bomert
Psychosoziale Beratung im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen. Empirische Erkenntnisse zur Struktur, Praxis und Bedeutung nach § 219 StGB
-
Welche Funktion hat die verpflichtende Schwangerschaftskonfliktberatung tatsächlich für ungewollt Schwangere? Hat sie einen Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft? Und wie gestalten Beratende das Gespräch, in dem gleichzeitig „ergebnisoffen“ (§ 5 Abs. 1 SchKG), aber dennoch „zum Schutz des ungeborenen Lebens“ (§ 219 Abs. 1 StGB) beraten werden soll?
-
Dr.in Christiane Bomert ist Akademische Rätin in der Abteilung Sozialpädagogik der Universität Tübingen. Sie forscht zur Professionalisierung sozialpädagogischer Beratung (insbesondere in der § 219-StGB-Beratung), zu Familie, Care und Soziale Arbeit (aktuell leitend in einem Projekt zur Sozialpädagogischen Familienhilfe im Kontext der Coronapandemie) sowie zu Differenz- und Machtverhältnissen in pädagogischen Settings.
-
Hier geht’s zum dritten Diskussionspapier.
Diskussionspapier #2 (Februar 2024)
Judith Dubiski, Alina Jung, Theresa Köchl, Dr. Alexa Nossek
Unentscheidbare Entscheidungen.
Die 3 wichtigsten Erkenntnisse
-
Schwangeren Personen wird von ihrer Umwelt suggeriert, dass sie absolute Kontrolle über den Verlauf ihrer Schwangerschaft haben sollten. Dafür scheint Pränataldiagnostik (PND) ein hilfreiches Mittel zu sein. Zugleich werden Schwangere im Umgang mit (oft nicht eindeutigen) Ergebnissen der PND und damit einhergehenden, schwerwiegenden Entscheidungen allein gelassen. Sie müssen diese Entscheidungen zudem im Kontext einer behindertenfeindlichen Gesellschaft treffen. Beratung spielt hier eine wichtige Rolle, aber auch sie kann keine wirklich selbstbestimmte Entscheidung ermöglichen.
-
Ob und wie Pränataldiagnostik in Anspruch genommen und wie mit ihren Ergebnissen umgegangen wird, ist sozial, kulturell und religiös geprägt und oftmals von rassistischen und ableistischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Gleiches gilt für Beratung im Kontext von PND.
-
Es mangelt rund um Pränataldiagnostik an Zusammenarbeit und Vernetzung von Fachpersonal aus dem Gesundheitswesen und psychosozialer Beratung.
Expertise #2 (Februar 2024)
Dr. Marina Mohr (Cara Beratungsstelle zu Schwangerschaft und Pränataldiagnostik)
Beratung zu Pränataldiagnostik. Problemkomplexe um Entscheidungsfreiheit, Kontrollmöglichkeiten und warum Behinderung noch immer eine Indikation ist.
Anders als in den übrigen Sitzungen der Dialogwerkstatt wurde diese Expertise in Form einer Präsentation gegeben.
-
Welche Aussagen können eigentlich mittels vorgeburtlicher Untersuchungen getroffen werden? Welche Gefühle können auf schwangere Personen und Partner*innen zukommen, wenn sie in der Pränataldiagnostik einen auffälligen Befund erhalten? Und was kann die Entscheidung für oder gegen ein Kind mit (möglicher) Behinderung beeinflussen?
-
Dr. Marina Mohr ist studierte Soziologin und systemische Beraterin und Therapeutin. In der Beratungsstelle Cara arbeitet Dr. Marina Mohr zu den Themen Schwangerschaft, Pränataldiagnostik und reproduktive Rechte.
-
Hier geht’s zum zweiten Diskussionspapier.
Diskussionspapier #1 (Dezember 2023)
Judith Dubiski, Alina Jung, Theresa Köchl, Dr. Alexa Nossek
Pro Life, Pro Choice und die Graustufen dazwischen.
Die 3 wichtigsten Erkenntnisse
-
Es fördert den Dialog zu Schwangerschaftsabbrüchen, wenn Gleichzeitigkeiten und Ambivalenzen in den Positionierungen möglich sind und eine starre Einteilung von Pro Choice und Pro Life vermieden wird.
-
Auch vermeintlich gegensätzliche Standpunkte können inhaltliche Überschneidungen finden. So betont ein Großteil der Teilnehmenden z.B. die Notwendigkeit einer angemessenen Unterstützung von Schwangeren in Konfliktsituationen und fordert dafür den Ausbau der Beratungslandschaft – auch wenn diese Bedarfe ganz unterschiedlich begründet werden.
-
Damit Projekte wie die Dialogwerkstatt auch für Ehrenamtliche und Menschen mit körperlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen offen stehen, müssen bereits in der Projektplanung und –finanzierung Aufwandsentschädigungen und Budget für Assistenzkräfte und Sprachmittlungen mitgedacht werden.
Expertise #1 (Dezember 2023)
Dr. Jessica Bock
Die Debatten über den Schwangerschaftsabbruch von 1972 bis heute/ Akteur*innen – Diskurse – Argumente
-
Von der ehemals geteilten Bundesrepublik bis in die Gegenwart beleuchtet diese Expertise unterschiedliche Gesetzgebungen zum Schwangerschaftsabbruch und daran anknüpfende, gesellschaftliche Debatten und ihre Akteur*innen. Wie wurde der Schwangerschaftsabbruch in der DDR und BRD geregelt, bevor er 1995 für rechtswidrig, aber unter bestimmten Umständen straffrei erklärt wurde? Wieso gewinnt das Diskutieren über Abbrüche seit den späten 2010er-Jahren wieder an Bedeutung? Welche Positionen vertreten dabei Pro-Life-, Pro-Choice-Bewegungen und die Kirche – und welchen Einfluss haben sie möglicherweise auf politische Entscheidungen?
-
Dr. Jessica Bock ist studierte Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Aktuell forscht sie über den Schwangerschaftsabbruch in der DDR.
-
Hier geht’s zum ersten Diskussionspapier.