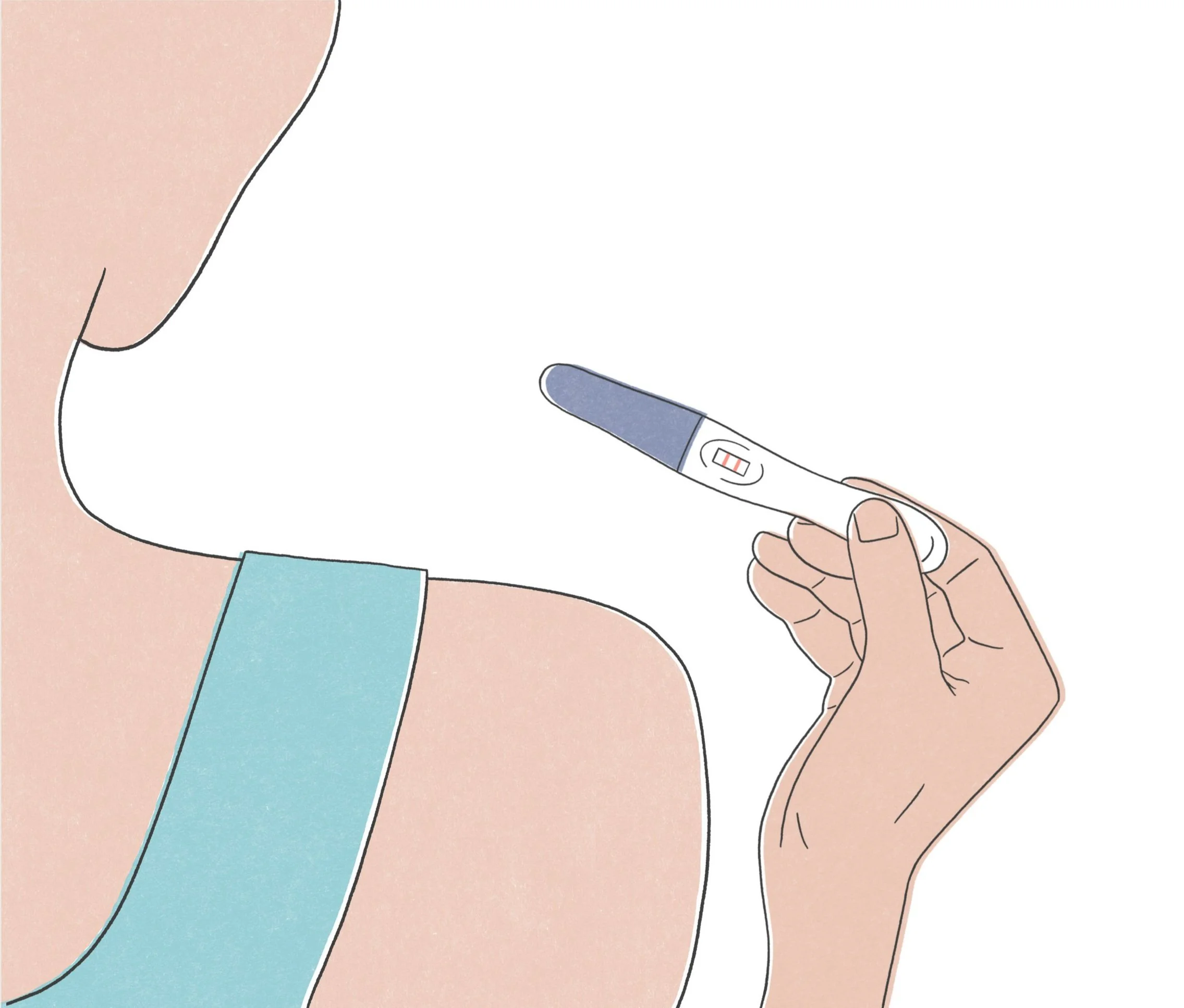Das ABC des Schwangerschaftsabbruchs.
Im Projektteam der Dialogwerkstatt verwenden wir Begriffe rund um den Schwangerschaftsabbruch. Dabei setzen wir uns zum Ziel, möglichst sachlich zu sprechen. Aber wieso sagen wir eigentlich „schwangere Person“? Und wie verstehen wir „Pro Choice“ und „Pro Life“? Antworten darauf finden Sie in diesem ABC, das als Orientierung für Gespräche zu Abbrüchen dienen kann.
E
-
Bezeichnet aus medizinischer Perspektive die früheste Entwicklungsstufe einer befruchteten Eizelle bzw. eines entstehenden Organismus. Von „Embryo“ spricht man im Regelfall von der ersten bis zur 9. Schwangerschaftswoche (nach Empfängnis). Neben dieser biologischen Perspektive kann die Definition eines Embryos auch religiöse, ethische und juristische Fragen aufwerfen: Wann beginnt Leben und hat ein Embryo bspw. bereits Grundrechte?
(vgl. Familienplanung: Embryo. Zuletzt aufgerufen am 27.11.23)
F
-
Während ein Schwangerschaftsabbruch das bewusste und vorzeitige Beenden einer Schwangerschaft meint, beschreibt der Begriff „Fehlgeburt“ das vorzeitige Ende einer Schwangerschaft, ohne dass die schwangere Person und medizinisches Personal dies entscheiden. Auch wenn der Begriff den Vorgang der Geburt impliziert, wird eine Fehlgeburt im rechtlichen Sinne nicht mit einer Entbindung (und entsprechendem Recht auf Mutterschutz) gleichgesetzt.
Von einer Fehlgeburt wird allgemein gesprochen, wenn ein Embryo/Fötus, der noch vor der 24. Schwangerschaftswoche (nach Empfängnis) steht, keine Lebenszeichen mehr aufweist und weniger als 500 Gramm wiegt. Ein Synonym für diesen Begriff kann „früher Schwangerschaftsverlust“ sein.
Vgl. Familienportal: Welche Regelungen gelten bei Fehlgeburt, Totgeburt oder Schwangerschaftsabbruch? Zuletzt aufgerufen am 10.04.24.Von einer „verhaltenen Fehlgeburt“ wird gesprochen, wenn ein Embryo/Fötus in der Gebärmutter keinerlei Lebenszeichen mehr zeigt, aber nicht durch eine Blutung abgeht. In diesem Fall kann in Absprache mit medizinischem Personal ein medikamentöser oder operativer Schwangerschaftsabbruch erfolgen.
Vgl. Die Techniker Krankenkasse: Fehlgeburten - worin sie sich unterscheiden. Zuletzt aufgerufen am 10.04.24. -
Bezeichnet aus medizinischer Perspektive die zweite Entwicklungsphase eines Organismus, die ab der 9./10. Schwangerschaftswoche (nach Empfängnis) beginnt. Ab diesem Zeitpunkt entwickelt ein Fötus alle lebenswichtigen Organe und Körperfunktionen. Bis zur möglichen Geburt wird ein Organismus als Fötus bezeichnet.
(vgl. Familienplanung: Fötus. Zuletzt aufgerufen am 27.11.23)
G
-
Eine Person, die grundsätzlich in der Lage ist, ein Kind auszutragen und zu gebären. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird synonym oft das Wort „Frau“ verwendet. Tatsächlich sind aber nicht alle gebärfähigen Personen Frauen (wenn sie ihr Geschlecht bspw. nicht als weiblich definieren) und nicht alle Frauen gebärfähig. Gründe dafür können sein: (eingeschränkte) Unfruchtbarkeit durch Erkrankungen (bspw. Endometriose) oder das Nicht-Vorhanden-Sein einer Gebärmutter (bspw. infolge einer medizinischen Entfernung).
K
-
Ein Schwangerschaftsabbruch kann vor Beendigung der 12. Schwangerschaftswoche (post conceptionem) ebenfalls straffrei sein, wenn eine „kriminologische Indikation“ vorliegt (siehe § 218a Abs. 3). Konkret bedeutet dies, dass nach ärztlicher Einschätzung eine Schwangerschaft höchstwahrscheinlich durch ein Sexualdelikt entstanden ist. In diesem Fall entfällt die gesetzliche Beratungspflicht.
M
-
Auch nach Beendigung der 12. Schwangerschaftswoche (post conceptionem) kann ein Schwangerschaftsabbruch straffrei sein, wenn eine „medizinische Indikation“ vorliegt (siehe § 218a Abs. 2). In Bezug auf die Schwangerschaftswoche wird hier keine rechtliche Grenze gesetzt. Ein Abbruch wird aus medizinischer Sicht in Betracht gezogen, wenn die schwangere Person sich bspw. in Lebensgefahr befindet oder ihre körperliche/ seelische Gesundheit schwerwiegend beeinträchtigt wird. In der Praxis zählen zu dieser Indikation vor allem mögliche genetische Erkrankungen eines Embryo bzw. Fötus. Berücksichtigt werden können auch familiäre oder soziale Umstände.
-
Innerhalb der ersten acht Wochen (konkret bis zum 63. Tag post menstruationem) einer Schwangerschaft kann diese nach ärztlicher Absprache durch die Einnahme von Tabletten abgebrochen werden. Zunächst wird eine Tablette mit dem Wirkstoff Mifepriston in einer ärztlichen Praxis eingenommen. Sie wirkt über ein künstliches Hormon, das v.a. Blutungen auslöst.
Circa zwei Tage nach der Einnahme dieser Mifepriston-Tablette wird eine zweite Tablette mit dem Wirkstoff „Prostaglandin“ eingenommen. Eingenommen werden kann diese nach Einschätzung der behandelnden Ärzt*innen entweder in einer ärztlichen Praxis oder zuhause. Ihre Einnahme verstärkt die Wirkung der Mifepriston-Tablette und das Schwangerschaftsgewebe (Fruchtsack inklusive Embryo, Gebärmutterschleimhaut, ggf. Gebärmutterhalsgewebe) werden ausgestoßen.
Auch im Falle eines medikamentösen Abbruchs ist eine gesetzliche Beratung vorgeschrieben, sowie die dreitägige Wartefrist vor Durchführung des Abbruchs. Ein medikamentöser Abbruch ist nicht mit der „Pille danach“ zu verwechseln. Die „Pille danach“ soll nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft verhindern, beendet aber keine bestehende. Konkret wird durch die „Pille danach“ der Eisprung der gebärfähigen Person verhindert, aber nicht das Einnisten einer befruchteten Eizelle.(vgl. Pro Familia: Schwangerschaftsabbruch – Abtreibung. Zuletzt aufgerufen am 21.11.23.; vgl. Familienplanung: Der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch. 2019. Zuletzt aufgerufen am 21.11.23.)
O
-
Eine Schwangerschaft kann ebenso durch einen operativen Eingriff abgebrochen werden. Dieser wird ambulant in einer Klinik oder Arztpraxis vorgenommen. Durchgeführt wird der Abbruch standardgemäß durch eine sogenannte Vakuumaspiration bzw. Absaugung. Dabei werden unter Vollnarkose oder örtlicher Betäubung durch ein Röhrchen Gebärmutterschleimhaut und die Fruchtblase inklusive Embryo/Fötus abgesaugt. Ein operativer Abbruch kann auch durch eine sogenannte Kürettage ausgeführt werden; auf diese Methode wird aufgrund einer höheren Komplikationsrate jedoch weniger häufig zurückgegriffen.
Auch beim operativen Abbruch ist eine gesetzliche Beratung vorgeschrieben, nach der man drei Tage warten muss, bevor der Eingriff erfolgt. Es handelt sich um eine ambulante Operation, d.h. die Person kann nach dem Eingriff normalerweise ohne anschließende Übernachtung die Praxis/ das Krankenhaus verlassen.
(vgl. Familienplanung: Der instrumentelle Schwangerschaftsabbruch. 2018. Zuletzt aufgerufen am 21.11.23; vgl. Pro Familia: Schwangerschaftsabbruch – Abtreibung. Zuletzt aufgerufen am 21.11.23.)
P
-
Bedeutet übersetzt „für die Wahlmöglichkeit“ und ist im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen ein Oberbegriff für feministische Perspektiven und Bewegungen. Vertreter*innen dieser Perspektive sprechen sich überwiegend häufig dafür aus, dass gebärfähigen Personen das Recht zusteht, sich selbstbestimmt für oder gegen das Austragen einer Schwangerschaft entscheiden zu können. Pro Choice kann demnach nicht automatisch mit dem Aussprechen für Abbrüche gleichgesetzt werden.
Die Pro-Choice-Bewegung hat ihren Ursprung in der US-amerikanischen Frauengesundheitsbewegung der 1960er-Jahre. In den vergangenen Jahren lässt sich im deutschsprachigen Raum eine Erweiterung der Themen der Pro-Choice-Vertreter*innen beobachten. Hier spielt der Begriff „reproduktive Gerechtigkeit“ (nach dem Konzept „Reproductive Justice“ von Loretta Ross) eine große Rolle. Gemeint ist damit grob zusammengefasst das Recht für alle, selbstbestimmt über den eigenen Körper, Sexualität, Gesundheit und Familienplanung entscheiden zu können. Auch wenn in der Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche ein Label wie „Pro Choice“ den Standpunkt einer Person verdeutlichen kann: Pro Choice ist keine einheitliche Bewegung, sondern eher eine Haltung, die Menschen unterschiedlich ausdefinieren können.
(vgl. Staggenborg, Suzanne: The Pro-Choice Movement. Organization and Activism in the Abortion Conflict. Oxford 1994) -
Bedeutet übersetzt „für das Leben“. Synonyme dafür sind „Lebensschutzbewegung“ oder „Lebensrechtbewegung“. Vertreter*innen dieser Perspektive sprechen sich überwiegend dafür aus, dass Schwangerschaften ausgetragen werden sollten. Damit soll Embryonen oder Föten die Chance auf Leben ermöglicht werden. Die Pro-Life-Bewegung hat ihren Ursprung in den 1970er Jahren in den USA. In den vergangenen Jahren lässt sich eine Erweiterung der Pro-Life-Themenfelder beobachten: Neben dem Schwangerschaftsabbruch wird ebenso die Legitimität von Pränataldiagnostik, Organtransplantation, Sterbehilfe u.a. diskutiert.
(vgl. Hansen, Felix; Jentsch, Ulli; Sanders, Elke: Deutschland treibt sich ab.“ Organisierter „Lebensschutz“, Christlicher Fundamentalismus, Antifeminismus. Münster 2014.)
Auch, wenn in der Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche ein Label wie „Pro Life“ den Standpunkt einer Person verdeutlichen kann: Pro Life ist keine einheitliche Bewegung, sondern eher eine Haltung, die Menschen unterschiedlich ausdefinieren können.
-
Durch die Pränataldiagnostik kann ein Embryo/ Fötus auf genetisch bedingte Krankheiten oder Behinderungen untersucht werden. Die Untersuchungen können sowohl non-invasiv durch bspw. Ultraschallbilder als auch invasiv durch bspw. das Abnehmen von Fruchtwasser erfolgen. Wird dem Embryo/ Fötus eine genetisch bedingte Krankheit oder Behinderung diagnostiziert, kann das die Chance bergen, bereits vor der Geburt entsprechende Therapien durchzuführen. Ebenso kann die schwangere Person sich durch Diagnosen auf die Umstände der Geburt vorbereiten und sich ggf. Hilfe in Form von Beratung suchen.
(vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Informationen zu Pränataldiagnostik. 2018. Zuletzt aufgerufen am 21.11.23.)Die Ergebnisse der PND sind jedoch nicht immer eindeutig und eine Garantie für ein gesundes Kind kann die Pränataldiagnostik ebenso wenig geben wie sie Aussagen über die Schwere und die lebenspraktischen Konsequenzen einer möglichen Behinderung treffen kann.
(vgl. Familienplanung: Was ist Pränataldiagnostik? Zuletzt aufgerufen am 27.05.24.)Ein auffälliger Befund kann in bestimmten Fällen auch eine medizinische Indikation nach sich ziehen. Das heißt, eine Schwangerschaft kann bei Vorliegen einer möglichen Erkrankung oder Behinderung des Fötus/ Embryos abgebrochen werden – und zwar dann, wenn die Diagnose des Embryos eine schwerwiegende Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren verursacht. Weil infolge der medizinischen Indikation indirekt suggeriert wird, welche Art von Embryonen oder Föten als „erwünscht“ angesehen werden, sind Methoden der Pränataldiagnostik teils umstritten.
S
-
Eine Person, die einen Embryo/ Fötus in sich trägt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird synonym oft das Wort „Mutter“ verwendet. Dennoch gibt es Personen, die schwanger sind, ihr Geschlecht aber nicht als weiblich definieren. Oder Menschen, die ungewollt schwanger sind und einen Abbruch möchten. Oder Personen, die ein Kind bspw. nach der Geburt zur Adoption freigeben und sich nicht mit der sozialen Rolle einer Mutter identifizieren.
-
Eine Schwangerschaft dauert im Durchschnitt 40 Wochen – wenn man die Zählung ab dem ersten Tag der letzten Periode beginnt. Diese Zählweise wird beschrieben mit dem lateinischen „post menstruationem/ p.m.“. Eine alternative Zählweise setzt am vermuteten Zeitpunkt der Empfängnis an und nennt sich „post conceptionem/ p.c.“. Die Empfängnis findet meist rund um den Eisprung statt, der circa zwei Wochen nach Beginn der Periode einsetzt. In diesem Zeitraum können Eizellen durch Spermien befruchtet werden.
(vgl. Frauenärzte im Netz: Schwangerschaftsdauer & Geburtstermin. 2018. Zuletzt aufgerufen am 21.11.2023).Relevant sind die Begriffe „post menstruationem“ und „post conceptionem“ u.a. im Kontext der Strafbarkeit eines Schwangerschaftsabbruchs. Rechtswidrig, aber straffrei ist ein Abbruch (ohne medizinische Indikation) grundsätzlich bis zur 14. Schwangerschaftswoche p.m. bzw. bis zur 12. Schwangerschaftswoche p.c.
-
Meint das vorzeitige und bewusste Beenden einer Schwangerschaft. Dies kann durch die Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten oder einen medizinischen, operativen Eingriff geschehen. Der Begriff „Schwangerschaftsabbruch“ taucht u.a. in Gesetzestexten in Hinblick auf dessen Strafbarkeit auf. Wir entscheiden uns für seine Nutzung, weil er aus unserer Perspektive neutral ist. Sprechen wir von „Schwangerschaftsabbruch“, nutzen wir im selben Kontext mitunter auch die Abkürzung „Abbruch“. Auf den Begriff “Abtreibung” verzichten wir.
(vgl. Krolzik-Matthei, Katja: Abtreibungen in der Debatte in Deutschland und Europa. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 2019. Zuletzt aufgerufen am 21.11.23)
-
Wer schwanger ist und sich in einem Entscheidungskonflikt befindet, kann sich an Beratungsstellen wenden. Dieses Gesprächsangebot wird von verschiedenen öffentlichen und freien Trägern gemacht. Ebenso beraten religiös oder autonom ausgerichtete Vereine oder in einigen Fällen auch Ärzt*innen.
(vgl. Familienplanung: Wer berät mich? 2019. Zuletzt aufgerufen am 30.11.23)
Doch nicht alle dieser Träger führen staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatung (nach § 219 StGB und §§ 8, 9, 10 SchKG) durch. D.h. nicht alle sind befugt, eine Bescheinigung über das erfolgreiche Durchführen der Beratung auszustellen. Genau diese Bescheinigung brauchen schwangere Personen jedoch, wenn sie einen straffreien Abbruch nach § 218a StGB vornehmen lassen wollen. Die Bescheinigung weist nach, dass sich die schwangere Person mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen.
Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatung wird z.B. angeboten durch: Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Deutschland, donum vitae, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, pro familia u.a. Weitere Träger, die Beratungsscheine ausstellen, finden Sie hier.
Mehr zur Schwangerschaftsberatung finden Sie hier.
-
Es gibt keine einheitliche Definition dieses Begriffs. Manche Quellen sprechen bereits bei einem Abbruch nach der 12. Schwangerschaftswoche (nach Empfängnis) von einem „Spätabbruch“. Diese Definition richtet sich vermutlich nach der gesetzlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs durch § 218 StGB. Nach der 12. Schwangerschaftswoche (nach Empfängnis) kann ein Abbruch nur mit einer medizinischen Indikation straffrei für alle Beteiligten durchgeführt werden. Andere Quellen wiederum nennen Zeiträume zwischen der 20. und 24. Schwangerschaftswoche (nach Empfängnis). Diese Definition ist vermutlich auf die Annahme der Lebensfähigkeit eines Fötus in diesem Stadium zurück zu führen.
Ein Spätabbruch mit medizinischer Indikation kann beispielsweise durchgeführt werden, wenn eine Schwangerschaft die körperliche und/oder seelische Gesundheit der schwangeren Person gefährdet. In der Praxis gilt als Argument hierfür z.B. ein auffälliger Befund in der Pränataldiagnostik. Das heißt: Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass der Embryo/Fötus eine genetisch bedingte Krankheit oder Behinderung hat.
Was passiert bei einem Spätabbruch? Ein Spätabbruch kann operativ durchgeführt werden, also standardgemäß durch eine Vakuumaspiration bzw. Absaugung. Ist jedoch davon auszugehen, dass der Fötus bereits überlebensfähig ist, wird noch in der Gebärmutter und vor dem Abbruch der Herzstillstand ausgelöst, bspw. durch eine Kaliumchloridlösung. In diesem Fall kann von „Fetozid“ gesprochen werden.
Vgl. Familienplanung: Spätabbruch. Zuletzt aufgerufen am 10.04.24.
Vgl. Schwanger in Bayern: Stille Geburt. Zuletzt aufgerufen am 10.04.24.
T
-
Wenn ein Fötus nach der 24. Schwangerschaftswoche (nach Empfängnis) ohne Lebenszeichen geboren wird oder während der Geburt verstirbt und mindestens 500 Gramm wiegt, kann von einer „Totgeburt“ oder „stillen Geburt“ gesprochen werden. Sowohl das Gewicht als auch die Mindestanzahl der Schwangerschaftswochen definieren den Fötus in diesem Fall als lebensfähig – also anders als bei einer Fehlgeburt.
Der Unterschied zum Schwangerschaftsabbruch: Eine Totgeburt ist grundsätzlich keine bewusste, medizinisch umgesetzte Entscheidung gegen eine Schwangerschaft. Ebenso gilt eine Totgeburt rechtlich gesehen als Entbindung, ein Schwangerschaftsabbruch jedoch nicht.
Vgl. Familienportal: Welche Regelungen gelten bei Fehlgeburt, Totgeburt oder Schwangerschaftsabbruch? Zuletzt aufgerufen am 10.04.24.
Vgl. Schwanger in Bayern: Stille Geburt. Zuletzt aufgerufen am 10.04.24.
§
-
In Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch per se rechtswidrig, deshalb ist er auch über das Strafgesetzbuch (StGB) geregelt. Straffrei ist er unter bestimmten Umständen (die in § 218a StGB geregelt sind):
- wenn die schwangere Person den Abbruch verlangt und dem durchführenden medizinischen Personal dafür einen sogenannten Beratungsschein vorlegt (sog. “Beratungsregelung”). Diesen erhält sie, wenn sie sich mindestens drei Tage zuvor in einer staatlich anerkannten Beratungsstelle hat beraten lassen (zur rechtlichen Situation der Beratung siehe § 219 StGB).
- wenn der Abbruch durch eine*n Ärzt*in vorgenommen wird und seit Empfängnis (post conceptionem) nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.
Treffen die ersten beiden Punkte zu, sind aber seit der Empfängnis nicht mehr als 22 Wochen vergangen, bleibt ein Schwangerschaftsabbruch (nach § 219 StGB) für die schwangere Person ebenfalls straffrei. Andere Beteiligte (Ärzt*innen, medizinisches Personal) können sich dann jedoch strafbar machen. Ebenso ist ein Schwangerschaftsabbruch straffrei, wenn eine kriminologische Indikation vorliegt.Nach Beendigung der 12. Schwangerschaftswoche (post conceptionem) kann ein Schwangerschaftsabbruch ebenso straffrei sein, wenn eine sogenannte medizinische Indikation gilt.
Im April 2024 hat eine Sachverständigen-Kommission der Bundesregierung ihren Bericht zu Möglichkeiten der Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuchesvorgelegt. Ihre Empfehlungen:
- Schwangerschaftsabbrüche in der Frühphase der Schwangerschaft (bis zu 12. Schwangerschaftswoche nach Empfängnis) sollten rechtmäßig sein.
- Für Abbrüche in der mittleren Phase der Schwangerschaft (12.-22. Schwangerschaftswoche nach Empfängnis) steht dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zu.
- Außerdem sollten wie bisher Ausnahmeregelungen vorgesehen sein, zum Beispiel bei einer Gesundheitsgefahr der Schwangeren.
Zum vollständigen Gesetzestext des § 218 StGB geht es hier. -
Paragraph, der in Deutschland die sogenannte „Werbung für Schwangerschaftsabbrüche“ regelte. Ärzt*innen machten sich strafbar, wenn sie öffentlich (bspw. auf ihrer Website) Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellten (“Werbeverbot”). „Information“ meinte in diesem Kontext den Hinweis auf die Tatsache, dass Abbrüche bei den jeweiligen Ärzt*innen durchgeführt wurden. Dazu zählte auch die Angabe, bis zu welcher Schwangerschaftswoche und unter Verwendung welcher Methoden Abbrüche durchgeführt wurden.
Seit Juli 2022 ist dieser Paragraph jedoch gestrichen. Medizinischem Personal ist nun erlaubt, sachlich über die in der jeweiligen Praxis bzw. medizinischen Einrichtung angebotenen Möglichkeiten und Methoden von Schwangerschaftsabbrüchen zu informieren. Die Debatte um den Erhalt bzw. die Streichung des § 219a StGB zog sich über Jahrzehnte hinweg. Sie wurde sowohl innerhalb der deutschen Parteienlandschaft als auch zwischen Vertreter*innen von Religionsgemeinschaften und Aktivist*innen verschiedenster Lager geführt. Mehr dazu hier.Zum ehemaligen Gesetzestext des § 219a StGB hier.
Sie haben Anmerkungen zu einem Begriff oder Ihnen fehlen Informationen?